Ferdinand von Schirach: Der Fall Collini
 Der Rechtsanwalt und Autor Ferdinand von Schirach hat seinen ersten Roman veröffentlicht. Wie bei seinen Erzählungsbänden „Verbrechen“ und „Schuld“ schöpft von Schirach aus seinem Erfahrungsschatz von mehr als 15 Jahren Anwaltstätigkeit. Während bei den Erzählungen die unglaublichen aber wahren Geschichten im Mittelpunkt standen, wie ganz „normale“ Menschen in Verbrechen verwickelt wurden (sei es als Opfer oder Täter), so nimmt der Autor sich nun die Zeit, einen Gerichtprozess in Romanlänge zu schildern. Das bedeutet gleichzeitig Gewinn und Verlust.
Der Rechtsanwalt und Autor Ferdinand von Schirach hat seinen ersten Roman veröffentlicht. Wie bei seinen Erzählungsbänden „Verbrechen“ und „Schuld“ schöpft von Schirach aus seinem Erfahrungsschatz von mehr als 15 Jahren Anwaltstätigkeit. Während bei den Erzählungen die unglaublichen aber wahren Geschichten im Mittelpunkt standen, wie ganz „normale“ Menschen in Verbrechen verwickelt wurden (sei es als Opfer oder Täter), so nimmt der Autor sich nun die Zeit, einen Gerichtprozess in Romanlänge zu schildern. Das bedeutet gleichzeitig Gewinn und Verlust.
Der Gewinn: Es bereitet dem Laien unglaublichen Genuss, hinter die Kulissen des Justizsystems zu schauen. Der Leser kann die Luft in den Gängen des Moabiter Gerichtspalastes förmlich riechen. Und kopfschüttelnd wird er am Ende des Buches wieder ein klein wenig mehr an der Vereinbarkeit von Recht und Gerechtigkeit zweifeln.
Der Verlust: Die Erzählinstanz, der anonyme Strafverteidiger, der in den Erzählungen die Fälle in der Ich-Form referierte – eiskalt und ohne etwas von sich preiszugeben – bekommt nun einen Namen und eine Biografie. Dadurch wird er nun selbst zu einer Figur, die der Beobachtung und Analyse ausgesetzt ist. Der Roman wird dementsprechend in der dritten Person erzählt. Wir nehmen Teil am Schicksal Caspar Leinens, der aus Versehen die Verteidigung des Mannes übernimmt, der den Großvater seiner großen Liebe ermordet hat.
Aber wie harmlos klingt das im Vergleich zu den Berichten des anonymen Ich-Erzählers in den Geschichten! Jenem Ich-Erzähler, der sich jeglicher Wertung enthielt: so als sei ihm eine Wertung juristisch nicht gestattet – was für ein Kunstgriff! Der auf zehn, zwanzig Seiten Dramen schilderte, die ein anderer Autor nicht auf Hunderten von Seiten zu schildern imstande wäre.
Ich frage mich, was den Autor bewogen hat, als drittes Werk einen Roman zu veröffentlichen. Wollte er beweisen, dass er das kann? Hat der Verlag ihn dazu gedrängt, nach zwei – zugegebenermaßen – erfolgreichen Erzählungsbänden nun auch einen „richtigen“ Roman zu schreiben, in der Hoffnung, dieser würde sich noch besser verkaufen?
Doch selbst wenn der Roman die Verkaufszahlen der Erzählungsbände übertrifft, so bleibt doch zu bedauern, dass die Auswalzung auf Romanlänge auf Kosten der Wucht der Erzählung geht. Jedem anderen Autor würde ein Roman wie „Der Fall Collini“ zur Ehre gereichen. Für Ferdinand von Schirach aber bedeutet er einen kleinen Schritt zurück.
Ferdinand von Schirach: „Der Fall Collini“. Roman. Piper Verlag, München 2011, 198 S., 16,99 Euro.
Leif Allendorf
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gänseblümchen im Asphalt
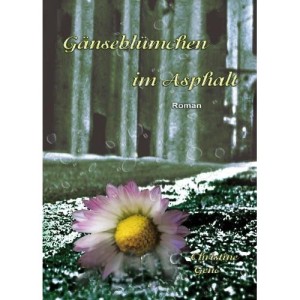 „Man sitzt vor einer weißen Wand, nur der Bildschirm leuchtet.“ Dies ist die klassische Situation des Schriftstellers, der sich sammeln muss, bevor er darangehen kann, seine Gedanken und Erinnerungen zu gestalten, in eine Form zu bringen, die es erlaubt, seine Empfindungen anderen Menschen mithilfe von Literatur erlebbar und nachvollziehbar zu machen.
„Man sitzt vor einer weißen Wand, nur der Bildschirm leuchtet.“ Dies ist die klassische Situation des Schriftstellers, der sich sammeln muss, bevor er darangehen kann, seine Gedanken und Erinnerungen zu gestalten, in eine Form zu bringen, die es erlaubt, seine Empfindungen anderen Menschen mithilfe von Literatur erlebbar und nachvollziehbar zu machen.
Es ist dies der erste Satz des Romans „Gänseblümchen im Asphalt“, den die österreichische Künstlerin und Schriftstellerin Christine Genc im vergangenen Herbst im in Wiernsheim ansässigen Artio Wortkunstverlag veröffentlich hat. Christine Genc ist eigentlich Lyrikerin, und das merkt man ihrem ersten Roman auch an: Das Bild ist wichtiger als die Grammatik; wo beide in einen Widerspruch geraten, muss sich letztere dem ersteren beugen – genau wie in der Lyrik. Hinzu kommt der Gebrauch österreichischer Redewendungen und der Weigerung, die Mundart in das Korsett des Hochdeutschen zu pressen. Dem Buch verleiht dies seine ganz eigene Atmosphäre.
„Wien fehlt mir. Die kleinen Gasserln, die Kaffeehäuser, die Freunde. Der Zug wartet auf mich. Ich springe auf und ab nach Hause. Wieder das Säuseln der Räder. Ich bin süchtig danach. Wien Westbahnhof. Berlin läuft wie ein Film ab. Ich atme Wiener Luft.“
Erzählt wird: ein ganzes Leben, ein Frauenleben von der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Protagonistin die Weichen für die Zukunft ihres heranwachsendes Kind stellt. Eine Kindheit im Wiener Zehnten Bezirk mit einem liebevollen, aber früh verstorbenen Vater und einer überforderten Mutter. Eine Kindheit mit ersten Erfahrungen des Missbrauchs, der von den Erwachsenen als reine Erfindung abgetan wird. Als junges Mädchen bleibt der Protagonistin nur die Flucht: in die Arbeitswelt, in ferne Länder und schließlich in Beziehungen mit Männern, die jedes Mal mit den gleichen Erfahrungen der Gewalt und des Missbrauchs enden.
Ohne die Schrecken des Erlebten mit künstlerischen und dramaturgischen Mitteln abzumildern, lässt die Autorin den Leser teilhaben, immer hautnah an der Protagonistin, atemlos erzählt. Das titelgebende Gänseblümchen im Asphalt ist das Bild für den unbebrochenen Mut der Heldin, auch in der aussichtslosesten Lage nicht die Hoffnung zu verlieren.
„Wer einmal vom Wasser der Kunst gekostet hat, wird immer wieder trinken“, sagt Christine Genc. Und so – wie könnte es anders sein – ist ihr zweiter Roman bereits in Arbeit…
Christine Genc: Gänseblümchen im Asphalt. Roman. Artio wortkunst Verlag 2011. ISBN: 978-3863422554. 180 Seiten, EUR 19.90.
Leif Allendorf
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NAURU ist überall
 In seiner Studie „Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen“ beschreibt der Amerikaner Jared Diamond in einem Gedankenspiel, wie der letzte Baum der Osterinsel von der Urbevölkerung gefällt wurde. Der ganze Wald ist bereits abgeholzt worden, damit die Pazifikbewohner die berühmten Steinstatuen errichten und transportieren konnten. Nun ist nur noch ein letzter Baum übrig. Die Bewohner der Osterinsel waren keine dummen Kreaturen, es waren Menschen von Verstand wie wir. Und trotzdem fällten sie um etwa 1500 nach Christus den letzten Baum und zerstörten damit sehenden Auges die letzte Möglichkeit, dass sich die Insel wieder bewaldete. Was mag den Holzfällern durch den Kopf gegangen sein, als sie den letzten Baum der Insel mit ihren Steinäxten niederwarfen?
In seiner Studie „Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen“ beschreibt der Amerikaner Jared Diamond in einem Gedankenspiel, wie der letzte Baum der Osterinsel von der Urbevölkerung gefällt wurde. Der ganze Wald ist bereits abgeholzt worden, damit die Pazifikbewohner die berühmten Steinstatuen errichten und transportieren konnten. Nun ist nur noch ein letzter Baum übrig. Die Bewohner der Osterinsel waren keine dummen Kreaturen, es waren Menschen von Verstand wie wir. Und trotzdem fällten sie um etwa 1500 nach Christus den letzten Baum und zerstörten damit sehenden Auges die letzte Möglichkeit, dass sich die Insel wieder bewaldete. Was mag den Holzfällern durch den Kopf gegangen sein, als sie den letzten Baum der Insel mit ihren Steinäxten niederwarfen?
Fünfhundert Jahre später ereignete sich auf Nauru, einer ebenfalls kleinen isolierten Pazifikinsel, ein ähnliches Desaster. Die polynesische Bevölkerung benutzte keine Steinäxte, um ihre idyllische Heimat zu ruinieren. Auch waren Bagger, Kräne und Fabrikschlote nicht das Mittel, um den Untergang herbeizuführen (obwohl sie der Insel ihre Spuren hinterlassen haben). Das Inselparadies am anderen Ende der Welt wurde mithilfe der freien Marktwirtschaft zerstört.
Nauru ist etwa 20 Quadratmeter groß und wird von weniger als 10.000 Menschen bewohnt. Der Vogelkot hat sich auf der Oberfläche aus abgestorbenen Korallen im Laufe der Jahrtausenden zu einer Phosphatschicht vermengt. Phosphat ist eine Ressource, die sich mit Erdöl vergleichen lässt. Weltweit werden damit ausgelaugte Böden gedüngt. So wie die Industrie Erdöl benötigt, ist die globale Landwirtschaft auf Phosphat angewiesen. Wer über diese Ressource verfügt, ist reich. Und Nauru bestand aus Millionen und Abermillionen Tonnen dieser Substanz.
In der Zeit vor, während und nach den beiden Weltkriegen war Nauru ein Spielball der Kolonialmächte und Machtblöcke. Doch in den 60er Jahren hatten einige junge Inselbewohner Universitäten in Australien und die USA besucht und wussten nun, wie die westliche Welt ihre Heimat ausbeutete. Nach jahrelangen zähen Verhandlungen erlangte die Insel 1968 seine Unabhängigkeit und die alleinige Kontrolle über den Handel mit Phosphat, der bislang in der Hand britischer und australischer Firmentrusts gelegen hatte. Die unermesslichen Erträge flossen direkt in die Taschen der Inselbewohner und machte die bislang armen Menschen quasi über Nacht zu Millionären.
Auf der anderen Seite der Erdkugel hatte 40 Jahre zuvor die Schließung einer Fabrik im österreichischen Marienthal alle Bewohner des Dorfes von einem Tag auf den anderen um ihren Job gebracht. Die Arbeitslosen von Marienthal, die nun plötzlich alle Zeit der Welt hatten, verfielen in völlige Lethargie und passive Resignation: die Bücherei blieb unbesucht, das Vereinsleben erstarb. Was die plötzliche Armut in Österreich angerichtet hatte, bewirkte auf Nauru der unvermittelte Reichtum. Von der Notwendigkeit der Erwerbstätigkeit befreit verbrachten die Nauruer ihre vollständige Zeit damit, ihr Geld mit vollen Händen auszugeben, mit wöchentlich neu erworbenen Luxusautos um die einzige Straße der Insel zu kurven und chinesischen Gastarbeitern die Maloche des Phosphatabbaus zu überlassen.
Wer zu viel Geld hat, um es auszugeben, der legt es an. Und wird es richtig angelegt, dann bringt dies noch mehr Geld, das wiederum angelegt werden muss. Die Befreier Naurus hatten dies auch geplant, um die Zukunft des winzigen Inselstaates zu sichern. Irgendwann würden die Phosphatvorkommen erschöpft sein – und dann musste Nauru auf anderen Beinen stehen. Durch Unerfahrenheit und Leichtsinn gerieten die Dollarmillionen in die Hände windiger Spekulanten, die es darauf angelegt hatten, die Naivität der Nauruer zu benutzen, um sich selbst zu bereichern. Das dafür verantwortliche Establishment Naurus – fast jede Familie stellte irgendwann einen verantwortlichen Minister oder Behördenchef – fürchtete sich, die Fehlschläge einzugestehen und versuchte, die Verluste mit noch größeren Unternehmungen wiedergutzumachen, die allerdings noch größere Verluste verursachten. Verdrängung und Verleugnung der dringendsten Probleme und Fehlentwicklungen ließen das reichste Land der Erde unausweichlich auf den ökonomischen Untergang zusteuern. Den Abschluss der unabwendbaren Abwärtsspirale stellte der verzweifelte Versuch dar, mit Krediten wieder zu Geldmitteln zu kommen, was aber letzten Endes nur bewirkte, dass weitere Kredite aufgenommen werden mussten, um die Zinsen des vorhergehenden Darlehens zu beziehen.
Überliefert hat uns diese Geschichte der französische Journalist Luc Folliet in seinem Buch „NAURU – Die verwüstete Insel. Wie der Kapitalismus das reichste Land der Erde zerstörte“, das soeben im Wagenbach-Verlag erschienen ist. Ende 2005 reiste er nach Nauru, „um selbst zu sehen, ob das alles wahr ist“. Können wir s glauben? Auf GoogleEarth kann man den Namen der Insel eingeben. Die Weltkugel dreht sich, wendet uns den unendlichen Pazifischen Ozean zu und zoomt auf eine winzige Insel, etwa vier Kilometer lang und drei Kilometer breit. Wir können weiter hinabtauchen und erkennen die Ringstraße, die entlang der Küste einmal um die Insel führt. Wir erkennen die Start- und Landebahn im Süden, direkt neben der Hauptstadt Yare. Im Nordosten sehen wir den verfallenen Fischereihafen Yanibare.
Die Bewohner von Nauru sind nicht törichter als andere Menschen. Auf ihrer winzigen Insel zeigen sich die Folgen ihres Handels nur rascher. Sie taten nichts anderes als die Ölstaaten, die mit gigantomanischen Bauvorhaben protzen, aber völlig verdrängen, dass die Millionen von Petrodollars mit dem schwarzen Gold versiegen. Und nichts anderes als jeder Bewohner der westlichen Welt, der dem Klima nichts mehr wünscht als dass es sich wieder erholt, der aber, wenn er aufgefordert wird, auf Autofahren und zwei Ferienflüge im Jahr zu verzichten, der Ansicht ist, das gehen nun wirklich zu weit, da müsse das Klima eben Zugeständnisse machen.
Das eingangs erwähnte Fällen des letzten Baums der Osterinsel ist ein noch viel schlimmeres Verbrechen, wenn man bedenkt, dass die Osterinsulaner ihr Eiland für die ganze Welt und sich selbst für die einzigen Bewohner hielten. Sie glaubten also nicht nur, den letzten Baum ihrer Insel, sondern den letzten Baum des ganzen Planeten zu zerstören. Was den Menschen der Osterinsel nicht möglich ist, könnte die globalisierte Wirtschaftsgesellschaft schaffen: die weitgehende Vernichtung der eigenen Zivilisation. Und wenn das geschieht, dann tun wir eines Tages das, was die Nauruer seit dem Zusammenbruch ihrer Wirtschaft tun: Mit einer Angel ans Ufer treten, um etwas auf dem Mittagstisch zu bekommen.
Luc Folliet: Nauru – Die verwüstete Insel. Wie der Kapitalismus das reichste Land der Erde zerstörte. Wagenbach-Verlag 2011. 138 S., 10.90 EUR.
Leif Allendorf
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thomas Mann in Amerika
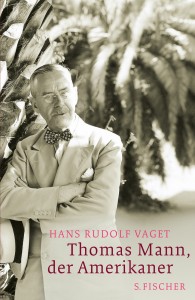 Sachbücher über Thomas Mann, den Thronheiligen der Literatur, gibt es meterweise. Biografien über den Großmeister haben mitunter vierstellige Seitenzahlen. Ist es nun notwendig, noch einmal 500 eng bedruckte Seiten zu füllen, die sich allein den Jahren 1938 bis 1952 beschäftigen, die Mann in den USA gelebt hat?
Sachbücher über Thomas Mann, den Thronheiligen der Literatur, gibt es meterweise. Biografien über den Großmeister haben mitunter vierstellige Seitenzahlen. Ist es nun notwendig, noch einmal 500 eng bedruckte Seiten zu füllen, die sich allein den Jahren 1938 bis 1952 beschäftigen, die Mann in den USA gelebt hat?
Es ist unbedingt notwendig – und es ist fesselnd, wie Hans Rudolf Vaget in dem Band „Thomas Mann, der Amerikaner“ beweist. Denn erst der Thomas Mann-Herausgeber Vaget stellt die einzelnen Aspekte des US-Exils – Emigrantenschicksal, Manns gescheitertes Verhältnis zu Hollywoods Filmindustrie, die Hexenjagd McCarthys sowie Manns Loyalität zu „seinem“ Präsidenten Roosevelt – in einen umfassenden zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Und das wiederum lässt die Person Thomas Manns in einem ungewohnten Licht erscheinen.
Die Vereinigten Staaten waren von jeher ein begehrtes Ziel für Zuwanderer. In den Jahren nach Hitlers Machtergreifung eskalierte der Flüchtlingsstrom aus Europa, was für die Situation der Flüchtlinge katastrophale Folgen hatte. Wer es über den Atlantik geschafft hatte, hatte unter Umständen sein Leben gerettet, sah sich aber neben einfacher Sprachschwierigkeiten meist Armut, Entwurzelung und Existenzangst ausgesetzt. Von Thomas Mann wissen wir aber, dass er in einem noblen Haus in der besten Gegend von Los Angeles wohnte, auf umfangreichen Vortragsreisen ausschließlich erster Klasse fuhr und auch sonst keine Not litt. Dabei hatte der 63jährige Einwanderer nur mäßige Englischkenntnisse, und die Übersetzungen seiner Romane waren in Amerika keine Bestseller.
Es gab eine Gönnerin, die dem Schriftsteller quasi den roten Teppich ausrollte: die deutschstämmige Agnes Meyer, erfolgreiche Journalistin, verheiratet mit einem einflussreichen, steinreichen Mann und glühende Thomas Mann-Verehrerin. Die Mittvierzigerin ließ keinen Zweifel daran, dass sie mehr zu sein wünschte als nur Muse des Dichters. Doch dem gelang es, die Anbetung in eine Art ideelle Geistesverwandtschaft umzumünzen und weder ihre noch seine Ehe zu gefährden. Direkt abweisen durfte er sie nicht, schließlich verschaffte sie ihm Posten, die ein solides Einkommen sicherten, die aber vom Arbeitsaufwand her nur symbolische Leistungen erforderten, so etwa eine Stelle als „Lecturer“ der US-Nationalbibliothek.
 Außerdem konnte man zu dieser Zeit mit jeder Art von Vorträgen gutes Geld verdienen, diese Veranstaltungen waren so beliebt wie heute Rockkonzerte. Und Thomas Mann hatte eine Botschaft, die er auf förmlichen Ochsentouren kreuz und quer durch die Staaten verbreitete: Er als Deutscher drängte die USA, den Hitlerstaat mittels Krieg niederzuwerfen. Denn auch wenn dies Schmerz und Tod mit sich bringen würde, sei dies das einzige Mittel, noch größeres Unheil zu verhindern. Diese Botschaft machte Thomas Manns Exil nicht zu einem erlittenen Schicksalsschlag, sondern förmlich zu einer Berufung.
Außerdem konnte man zu dieser Zeit mit jeder Art von Vorträgen gutes Geld verdienen, diese Veranstaltungen waren so beliebt wie heute Rockkonzerte. Und Thomas Mann hatte eine Botschaft, die er auf förmlichen Ochsentouren kreuz und quer durch die Staaten verbreitete: Er als Deutscher drängte die USA, den Hitlerstaat mittels Krieg niederzuwerfen. Denn auch wenn dies Schmerz und Tod mit sich bringen würde, sei dies das einzige Mittel, noch größeres Unheil zu verhindern. Diese Botschaft machte Thomas Manns Exil nicht zu einem erlittenen Schicksalsschlag, sondern förmlich zu einer Berufung.
Der Tod Roosevelts am Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutet eine Zäsur für den deutschen Schriftsteller in Amerika. Das Klima ändert sich – die Hexenjagd auf vermeintliche Kommunisten eines gewissen republikanischen Senator namens McCarthy beginnt. Den konservativen bürgerlichen Thomas Mann als Kommunist zu verdächtigen ist absurd, aber FBI-Chef Hoover hatte seine eigene Methode. Wer pazifistische oder soziale Aufrufe unterschreibt, ist Kommunist – basta. Ein öffentlicher Vortrag in der US-Nationalbibliothek wird abgesagt, und Thomas Mann kann froh sein, nicht vor dem berüchtigten „Ausschuss für unamerikanische Tätigkeiten“ zitiert zu werden.
1952, drei Jahre vor seinem Tod, verlässt Thomas Mann die USA und kehrt in den deutschen Sprachraum zurück. Wie vor seinem Amerikaaufenthalt wird auch jetzt wieder die Schweiz seine Wahlheimat. Von dort aus sieht er sich noch einmal in eine hässliche Auseinandersetzung verwickelt. Die Schriftsteller der sogenannten inneren Emigration deuteten ihren „Rückzug ins Schweigen“ als den eigentlichen Widerstand gegen das NS-Regime, während die Exilanten das Geschehen von ihren „Logenplätzen“ aus in bequemer Entfernung verfolgt hätten. Dabei war es Thomas Mann, der als einer der ersten die Judenvernichtung in den Konzentrationslagern öffentlich anprangerte, von der die Deutschen später behaupteten, von nichts gewusst zu haben. Die Umkehrung von Täter und Opfer gipfelt in der Behauptung Walter von Molos, das deutsche Volk habe keine kollektive Schuld auf sich geladen, vielmehr habe es für die anderen Völker „die Kohlen aus dem Feuer“ geholt.
Dieser schärfste und bedeutendste deutsche Literaturstreit sollte sich noch lange nach Thomas Manns Tod hinziehen. Kaum zu glauben, dass er, dieses Idol bürgerlicher Kultur, bei den Konservativen noch in den siebziger Jahren eine persona non grata war. Vagets umfangreiche aber immer spannende Studie gelingt es, die verschiedenen Aspekte von Thomas Manns USA-Exils so zu schildern, dass sie immer wieder an Fragen unserer Gegenwart erinnern und der Leser keinen Augenblick den Eindruck hat, hier würde trockenes Gelehrtenwissen ausgebreitet. „Thomas Mann, der Amerikaner“ ist ein brandaktuelles Buch.
Hans Rudolf Vaget: Thomas Mann, der Amerikaner. S.-Fischer Verlag, 545 S., EUR 24,95
Leif Allendorf
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….














